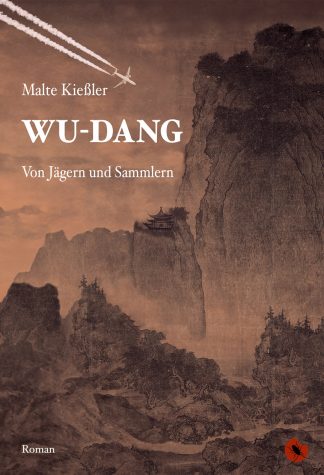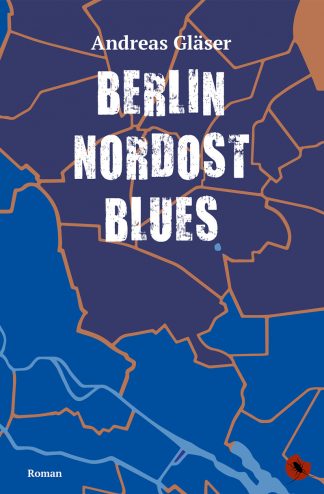Ein Interview mit Florian Langbein
Florian Langbein ist ein Slam-Poet aus Göttingen und hat bei Periplaneta zwei Romane veröffentlicht. Swantje Niemann sprach mit ihm über das Schreiben, Slammen, Antihelden, Fight Club und die alten Griechen.
P: „Friedensweide“ ist nun schon dein zweiter Roman. Hast du das Schreiben deshalb anders erlebt als bei deinem Debütroman?
FL: Ja, ich habe das Schreiben ganz extrem anders erlebt. „Wetterleuchten“ war ein sehr anarchistischer Roman, in ihm hätte an jeder Stelle alles mögliche passieren können, und er ist über drei Jahre genauso anarchistisch und chaotisch geschrieben worden: Je nachdem, wie ich Lust hatte, habe ich mal ein Kapitel geschrieben, in dem ich ein paar Autos in die Luft gejagt habe, dann habe ich das Manuskript wieder drei Wochen liegen lassen, dann wieder ein Kapitel gelöscht und ein neues Ende geschrieben, obwohl der Anfang noch nicht fertig war, und so weiter. „Friedensweide“ dagegen ist der Struktur nach ein Krimi – Whodunnit? – und als solcher viel stärker von Regeln beherrscht. Auch der Handlungsraum, das Dorf, folgt klaren Abläufen: So war auch das Schreiben ein sehr geregelter Prozess. Ich habe Pläne geschrieben, die Handlung aufgezeichnet, die Intrige entwickelt, und mich dann hingesetzt und Kapitel für Kapitel ausgearbeitet.

P: Statt es deinen Figuren leicht zu machen, erzählst du gerne Geschichten von tragischem Scheitern. Was reizt dich daran?
FL: Ich glaube, ohne Scheitern kann es keine guten Romane geben. Warum sollte man auch von einem „gelungenen“ Leben erzählen? Schule, Ausbildung/Studium, Beruf, Ehe, Haus, Kinder, Rente, Tod. Das ist die Geschichte von Millionen von Menschen und vielleicht auch – oder sehr wahrscheinlich – meine Geschichte. Wir sind derart auf solche gelungenen Biographien konditioniert, dass alle anderen Lebensentwürfe und -konzepte zwangsläufig ein Scheitern beinhalten, oder als gescheitert gedacht werden. Darum geht es auch in „Friedensweide“. Dass sämtliche Lebensentwürfe, die sich über die Grenzen bürgerlichen Lebens hinaus bewegen, scheitern, ist auch eine Aussage über unsere Zeit und unsere Umgebung: Dass man als Mensch im Sinne der herrschenden Ordnung gelingt, ist alternativlos: Das „Glück“ des Konsums ist alternativlos, selbst die Gescheiterten sind Konsumenten. Wenn Menschen also scheitern, bestätigen sie trotzdem das System. Von diesem Dilemma möchte ich erzählen.
P: Die Figuren in deinem Debüt „Wetterleuchten“ inszenieren sich für kurze Zeit als die chaotischen Antihelden ihres persönlichen Dramas. Das erweist sich, soviel kann man verraten, im Handlungsverlauf als sehr schlechte Idee. Reagierst du damit auf die unreflektierte Bewunderung, die viele Antihelden in Film und Literatur erfahren?
FL: Ich würde diese Bewunderung nicht unreflektiert nennen. Antihelden wie Tyler Durden (Fight Club) oder Daniel Plainview (There will be blood) stellen doch Heldenideale in Frage, die so alt sind wie die Literatur selbst. „Helden“-Ideale gehen bis zu Homer zurück, zu Achilles und Odysseus als die heroischen Prototypen. Die Bewunderung von Antihelden ist viel reflektierter. Außerdem schreibe ich nicht als Reaktion auf etwas, auch wenn das Strickmuster vieler Film-Antihelden das gleiche ist wie das meiner Figuren. Es gibt gewisse Konstanten in Literatur und Film, die nicht zwangsläufig voneinander beeinflusst sein müssen. In “Wetterleuchten” sind sich viele der Figuren am Anfang schon sicher, dass ihr Unternehmen scheitern wird – sie wissen nur noch nicht, wie. Ich fand das spannend, weil es gegen die Logik geht, denn rein logisch handelt man mit einem gewünschten Ergebnis als Ziel der Handlung. Wenn man von vorneherein weiß, dass das Ergebnis der Handlung das Gegenteil von allem ist, was man sich wünscht, handelt man paradox – und doch sehr alltäglich. Warum rauchen Menschen? Warum rauche ich? Sicherlich nicht, weil Lungenkrebs ein wünschenswertes Ergebnis der Handlung darstellt. Man kann an sich selbst scheitern oder an der Umgebung. Aber wenn man weiß, dass man scheitern wird, und trotzdem handelt, bleibt nur eine Möglichkeit: Das eigene Scheitern zu inszenieren und zu glorifizieren.
P: Natürlich können wir nicht erwarten, dass du allzu viel von deinem Wissen preisgibst, aber was ist eine wichtige Lektion, auf die du in den Schreibworkshops, die du gibst, immer wieder zu sprechen kommst?
FL: Dass man nicht so viel auf „Lektionen“ geben sollte. Meine Workshops zielen mehr darauf ab, sich selbst auszuprobieren und für sich Freiräume zu schaffen, um das eigene Schreibverhalten kennen zu lernen. Kreativität auf Abruf ist möglich, aber dafür muss man sich und sein Arbeitsverhalten sehr gut kennen, sich selbst Rituale schaffen, die Kreativität triggern, und wissen, wie der eigene Kopf funktioniert. Literarische Technik kommt erst sehr viel später. Meine Lektionen lauten also nicht „Viele Adjektive ergeben eine anschauliche Beschreibung“, sondern eher nach Sokrates „Lerne dich selbst kennen“. Schreiben ist verlangsamtes Denken. Deshalb ist Schreiben auch besonders gut geeignet, sich selbst und das eigene Denken kennenzulernen. Schreiben bedeutet, sich auf eine Reise durch die eigenen Gedanken zu begeben und zu forschen, was sich da alles entdecken lässt.
P: Auf deiner Seite, auf der du auch davon erzählst, dass du als Slam Poet aktiv bist, heißt es: „Poesie sind keine Worte auf Papier, Poesie ist Energie, Bewegung und Emotion. Meine Texte sind in der Mehrheit politisch, ich würde sie – im Anschluss an mein Dissertationsthema – als Satiren bezeichnen.“ Worum geht es in deiner Dissertation?
FL: In meiner Dissertation geht es um die Satiren von Horaz, die 35 v. Chr. mitten im römischen Bürgerkrieg veröffentlicht wurden. Satire bedeutet ursprünglich „Vermischtes, buntes Allerlei“ und das erste Buch der Satiren beinhaltet zehn Gedichte von jeweils ca. 100 Versen Länge, die ganz verschiedene Themen bedienen, von Moralphilosophie bis Fäkalhumor. Sie spielen immer wieder – mehr oder weniger versteckt – auf den Bürgerkrieg an, was zu dieser Zeit eine hochgefährliche Sache war. Ich lese die Satiren als „vermischtes, buntes Allerlei“ von verschiedenen Literaturgattungen und meine, dass man daraus den politischen Gehalt der Gedichte systematisch erschließen kann. Literarische Gattungen haben oft auch eine politische Komponente: Es ist ja kein Zufall, dass Heinrich Heine sein „Wintermärchen“ in Volksliedstrophen dichtet, gerade als Ideen vom geeinten deutschen Volk und vom Nationalstaat in Mode kamen. In Bezug auf meine Dissertation ist das so: Wenn die griechische Komödie die griechische Politik aufs Korn nimmt und lächerlich macht, und Horaz auf die griechische Komödie und ihre Praxis anspielt, dann ist das eine politische Aussage.
P: Ist Poetry Slam als Literaturformat also das aktuelle Pendant zur griechischen Komödie?
FL: Im Slam ist das tatsächlich ähnlich: Die Themenvielfalt auf der Bühne hat als einheitliches Gattungsmerkmal eigentlich nur das satirische „Allerlei“, außerdem ist die Gattungsmischung auch etwas, das sich wunderbar mit der Freiheit der Slambühne und den freien Sprechversen verbinden lässt: Man kann im pathetischen Duktus von Schillerballaden triviale Alltagssituationen erheben oder die Sprechstimme einer Tierdoku dazu benutzen, zwischenmenschliche Grotesken pseudowissenschaftlich lächerlich zu machen.
P: Wie bist Du zum Poetry Slam gekommen?
FL: Ich habe im frühen Teenageralter ein paar Songtexte geschrieben, die ziemlich nahe am Deutschpunk waren, konnte aber keine Band gründen, weil ich dafür viel zu unmusikalisch war, selbst für Punkrock. Im zweiten Semester habe ich dann Slam entdeckt und bemerkt, dass Punk auch ohne Musik funktioniert, und habe mich mit meinen Texten dann auf die Bühne gestellt.
P: Die Liste deiner Erfolge auf Poetry-Slam-Bühnen ist lang. Wie bereitest du dich auf große Wettbewerbe vor?
FL: Ich habe mich immer sehr minutiös vorbereitet, habe die Texte auswendig gelernt und lange vor dem Spiegel geübt, habe mich selbst aufgenommen und immer wieder angehört, damit auch alle Betonungen sitzen, habe mir überlegt, was ich anziehe und wie ich gestikuliere. Ich war immer auch auch ziemlich ehrgeizig. Meistens sind große Wettbewerbe sowieso relativ chaotisch und verkatert (zumindest bei mir), so dass eine solch minutiöse Vorbereitung notwendig ist, um auf der Bühne zu funktionieren. Gleichzeitig habe ich aber auch sehr stark geübt, mir eine Fassade zuzulegen, die sagte „The points are not the point, wenn‘s schief geht, mei, dann ist das halt so, ich bin nur hier, um Spaß zu haben“. Das ist auf Dauer ziemlich anstrengend und wahrscheinlich auch sehr durchsichtig. Ich trete deshalb eigentlich nicht mehr bei großen Wettbewerben auf, mein Fokus hat sich ganz klar in Richtung der Romane verschoben. Ich bin sehr dankbar für kleine Bühnen, auf denen ich befreundete Slammer*innen ohne Konkurrenzdruck treffe und wir gemeinsam für eine gute Show da sind. Ich bin mit im Veranstaltungsteam des Göttinger Poetry Slams und trete auf vielen Lesebühnen da auf, die SpokenWord-Gala von Periplaneta besuche ich sehr gerne und gelegentlich absolviere ich noch mal eine Minitour bei alten Freunden, die Slams veranstalten. Das reicht mir und damit bin ich eigentlich sehr glücklich.
P: Hast du schon eine Idee für dein nächstes Buchprojekt?
FL: Ich denke schon. Aber das braucht wohl etwas Zeit. Mit „Wetterleuchten“ und „Friedensweide“ sind jetzt zwei sehr düstere Erzählungen in sehr rascher Folge erschienen. Eigentlich ist in meinem Leben aber alles sehr positiv. Düsternis und Bitterkeit schlauchen ziemlich. Ich möchte gerne etwas freundlicher schreiben, aber das muss ich wohl erst üben. Eine grobe Idee zum Plot habe ich schon, aber bis diese fertig entwickelt ist, dauert das noch. Ich bin auf jeden Fall gespannt darauf, einen Protagonisten zu schaffen, der so etwas wie Sympathien weckt und hoffe, dass mit das gelingt.
Wir danken für das Interview.
-
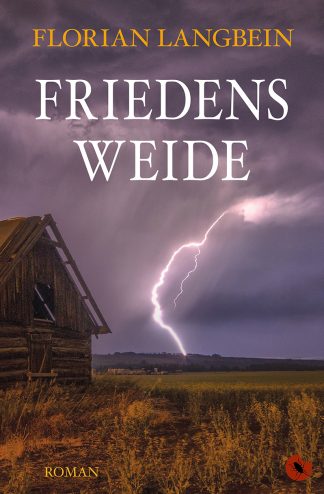 Friedensweide7,99 € – 13,50 €
Friedensweide7,99 € – 13,50 € -
 Wetterleuchten7,99 € – 13,50 €
Wetterleuchten7,99 € – 13,50 €